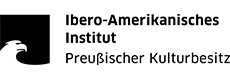El pelo de María
Después de intentar escribir poesía durante casi cincuenta años, concluyo que un poema es la flor de la mentira que son las palabras. Nunca alcanzan, no representan fielmente el corazón de lo que pienso o siento. Por ejemplo:
El pelo de María
en el avión rubio
azul de noche
siguiendo el mar
Me gustan esas palabras, esas cuatros líneas. Tengo una vaga idea de lo que sentí escribiéndolas al amanecer un lunes del año pasado. Había dormido muy poco después de ver por internet un partido de fútbol malísimo que terminó a las cuatro de la mañana. Estaba lloviendo, había tomado unos mates, tenía la cabeza medio vacía. Me salieron muchas más palabras vinculadas a esas primeras catorce que me parecían necesarias y provocadas por la imagen inicial del pelo de María, pero las borré ese mismo día. Las frases descartadas no eran ni mejores ni peores que las que guardé, pero no me llevaban a ninguna parte; la ambiciosa jugada había muerto al estrellarse contra el muro de la defensa. El problema era que el comienzo del poema había tomado el lugar de lo que yo realmente había sentido, y ya no tenía la menor idea de lo que quería expresar. Lo cierto es que, con o sin un poema para intentar recordar lo vivido, la memoria siempre me traiciona. Pensé que esos cuatro versos podrían ser útiles en algún futuro, y los archivé como tantos otros arranques fallidos, sabiendo en el fondo que nunca formarían parte de un buen poema. He leído buenos poemas de otros, y confío en la posibilidad de escribir uno. O sea, que existen los buenos poemas. Pero tampoco sé si eso es cierto. Puede que sea imposible escribir un poema realmente bueno, porque nunca va a ser la verdadera representación de la experiencia, del sentimiento o el pensamiento que lo impulsó.
Un poema es el registro de un fracaso. No digo que el poema tiene que ser un fracaso – aunque puede que todos los poemas sean fracasos, y por ahí también todos los cuadros, las esculturas, las fotos, los recitales, los bailes y las canciones – pero sí que
el poema parte de un deseo imposible, el de querer de alguna manera meter, aunque sea mínimamente o de forma inconsciente, la experiencia individual, personal, en un contexto universal. Sigo buscando un vínculo entre lo que pienso y lo que me rodea, aunque casi siempre termino insatisfecho, negando la conexión, lamentándola, incluso odiándola. Pero sigo escribiendo.
Un poema es una bomba casera, más o menos bien construida. Si logra estallar, sus fragmentos pueden alcanzar a alguien, armar una nueva idea, frase, una bomba más potente. Pero los poemas no funcionan por sí solos. Un poema no va a matar a nadie, ni puede eliminar a la poesía por mucho que podamos odiarla. De momento me quedo con esos cuatro versos que empiezan con “El pelo de María” porque siguen guardando cierto misterio, son un rompecabezas que no controlo intelectualmente, la huella de algo limpio. A ver si puedo encontrar una salida, si puedo añadir algo que funcione. Arranco de nuevo:
El pelo de María
en el avión rubio
azul de noche
siguiendo el mar
El mar de anoche
en el avión rubio
siguiendo el azul
pelo de María
El avión de María
en el mar rubio
siguiendo el pelo
azul de anoche
La noche rubia
del mar de pelo
en el avión azul
siguiendo a María
Bueno, esa última variación no está mal, promete. Podría seguir buscando más mutaciones de la copla inicial, o lanzarme por otro lado completamente ajeno al pelo de María en ese avión, pero de repente me gusta esta versión como arranque y, sobre todo, el verso “...siguiendo a María”. Me parece que esas tres palabras podrían ser el germen de una especie de confesión de deseo, de un cuento casi honesto, casi cierto. No sé quién es María, pero “La noche rubia / del mar de pelo / en el avión azul / siguiendo a María” tiene el potencial para armar una historia condenable, enfermiza, por muy falsa que sea. No tiene nada que ver con los orígenes del poema que quise escribir, que yo sepa, pero con ese cuarteto algo se podría rescatar, inventar. Ya ven, los poemas son una mentira, el registro de un fracaso y una bomba que podría estallar. En fin, creo que hay que proteger a la poesía de los poemas. Y de los poetas, sobre todo.
Marias Haar
Nachdem ich mittlerweile seit fast fünfzig Jahren versuche Poesie zu schreiben, komme ich zu dem Schluss, dass ein Gedicht die höchste Form der Lüge ist, die Lüge, die Worte ohnehin schon darstellen. Sie sind unzureichend, treffen nicht den Kern dessen, was ich fühle und denke. Hier ein Beispiel:
Marias Haar
im blonden Flugzeug
nachtblau
dem Meer hinterher
Ich mag diese Worte, diese vier Zeilen. Ich habe sogar noch eine vage Vorstellung davon, was ich fühlte, als ich sie niederschrieb, bei Sonnenaufgang an einem Montag vergangenes Jahr. Ich hatte kaum geschlafen, hatte bis vier Uhr morgens vor einem sauschlechten Fußballspiel im Internet verfolgt. Es regnete, ich hatte Mate getrunken, der Kopf war ziemlich leer. Auf diese ersten neun Worte folgten viele weitere, die mir notwendig erschienen, um das Ausgangsbild, Marias Haar, einzufangen, aber ich löschte sie noch am selben Tag. Die verworfenen Zeilen waren weder besser noch schlechter als die, die ich behielt, aber sie führten nirgendwo hin; der ambitionierte Spielzug scheiterte an der Abwehrmauer. Das Problem war, dass der Beginn des Gedichts den Platz dessen eingenommen hatte, was ich wirklich gefühlt hatte und ich danach überhaupt nicht mehr wusste, was ich hatte sagen wollen. Auf jeden Fall lässt mich mein Gedächtnis ständig im Stich, mit oder ohne Gedicht als Stütze. Ich dachte, die vier Zeilen könnten in irgendeiner Zukunft nützlich sein, also speicherte ich sie wie so viele andere gescheiterte Startversuche ab, wobei mir insgeheim klar war, dass sie niemals Teil eines guten Gedichts werden würden. Ich habe gute Gedichte von anderen gelesen und vertraue darauf, auch mal eins zu schreiben. Gedichte scheinen gelingen zu können. Absolut sicher bin ich mir allerdings nicht. Vielleicht ist es auch unmöglich, ein wirklich gutes Gedicht zu schreiben, weil dieses niemals ganz die Erfahrung, das Gefühl oder den Gedanken abbilden kann, die zum Schreiben führten.
Ein Gedicht steht immer für ein Scheitern. Damit sage ich nicht, dass ein Gedicht immer zum Scheitern verurteilt ist, obwohl es durchaus sein kann, dass alle Gedichte scheitern, und dass das auch auf alle Gemälde, Skulpturen, Fotos, Lesungen, Tanz- und Musikstücke zutrifft. Zweifellos geht ein Gedicht von dem unmöglichen Wunsch aus, auf irgendeine Weise, und sei sie noch so winzig oder unbewusst, die eigene, persönliche Erfahrung in einen universellen Zusammenhang zu stellen. Ich suche immer noch nach der Verbindung zwischen dem, was ich denke und dem, was mich umgibt, auch wenn ich in der Regel darüber unsicher werde, erst jegliche Verbindung anzweifle, sie dann bedaure und irgendwann sogar verachte. Trotzdem schreibe ich weiter.
Ein Gedicht ist eine mehr oder weniger geschickt zusammengebastelte Bombe. Wenn sie in hochgeht, kann es sein, dass jemand von ihren Splittern getroffen wird, oder dass eine neue Idee, ein Satz oder eine weitaus wirkungsvollere Bombe gezündet wird. Gedichte funktionieren aber nicht eigenständig. Weder bringt ein Gedicht jemandem um, noch ist es in der Lage, die Dichtung zunichte zu machen – auch wenn wir diese noch so sehr verachten. Ich behalte mal die vier Zeilen im Blick, die mit „Marias Haar“ beginnen, weil sie ein Geheimnis bergen, ein Rätsel aufgeben, das ich intellektuell nicht kontrollieren kann, die Spur von etwas Reinem. Schauen wir mal, ob ich den Dreh finde, ob ich etwas hinzufügen kann, das funktioniert. Ich fange nochmal an:
Marias Haar
im blonden Flugzeug
nachtblau
dem Meer hinterher
Das Meer letzte Nacht
luftblond
dem Blau
von Marias Haar hinterher
Marias Flugzeug
im blonden Meer
dem blauen Haar
von gestern Nacht hinterher
Die blonde Nacht
des Haarmeers
im blauen Flugzeug
Maria hinterher
Ich finde die letzte Variante nicht schlecht, sie verheißt etwas. Ich könnte die ursprüngliche Strophe weiter verschieben oder mich in eine völlig andere Richtung begeben, weit ab von Marias Haar und dem Flugzeug, aber als Auftakt gefällt mir diese Version jetzt – ganz besonders die Zeile „Maria hinterher“. Ich finde, diese zwei Wörter könnten der Keim für das Geständnis eines Verlangens sein, für eine einigermaßen ehrliche, realistische Erzählung. Keine Ahnung, wer Maria ist, aber „Die blonde Nacht/ des Haarmeers/ im blauen Flugzeug/ Maria hinterher“ hat das Potenzial für eine verdammt kranke Geschichte, und sei sie noch so zusammengesponnen. Sie hat, soweit ich weiß, nichts mit dem Gedicht zu tun, das ich ursprünglich schreiben wollte, doch mit diesem Quartett lässt sich etwas davon bewahren und etwas dazu erfinden. Ihr seht also, Gedichte sind reine Lüge, sie sprechen vom Scheitern und sind gleichzeitig eine Bombe, die vielleicht gleich hochgeht. Ich fürchte, man muss die Dichtung vor den Gedichten schützen. Und ganz besonders vor den Dichtern.