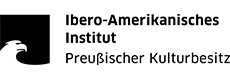Dreizehn Arten einen Gespenstersturm zu sehen, oder: Ein bisschen etymologischer Gossip für die Latinale. Von Uljana Wolf
I
Das Motto der diesjährigen Latinale ist „Translator’s Choice“. Sechs erfahrene Übersetzer:innen, die zum Teil auch selber schreiben, haben Dichter:innen aus Lateinamerika ausgesucht, die sie übersetzen möchten. Es gab also keine kuratierte Zuordnung, wie sie bei diesem und anderen Festivals üblich ist. Sondern es ging darum, einen Raum zu eröffnen, in dem sich darstellt, was Übersetzer:innen sehen, was sie lesen, was sie fasziniert, was sie schön finden, was sie verstört, was sie im besten Falle so schön verstört, dass sie damit ihre Zielsprache, das Deutsche, störend verschönern wollen. Der Untertitel des Festivals lautet „Übersetzen als poetische Utopie“. Da alle beteiligten Übersetzer:innen wunderbare Gedichte übersetzt haben, es diese Gedichte jetzt also gibt, nicht nur im Original, sondern als zweites Original, und da diese Texte in einer Anthologie versammelt sind, also einem zweiten oder dritten Ort neben ihrem ersten oder zweiten Ort, der ein unveröffentlichtes Notizheft oder ein veröffentlichtes Buch oder der Kopf der Dichterin ist, können mit der übersetzerischen Utopie, dem Nicht-Ort des Poetischen, also nicht diese Übersetzungen gemeint sein.
Das war ein recht gestapelter Satz, in dem dreimal das Wort Ort, zweimal das Wort Original und einmal das Wort Kopf vorkam, und zwar am Ende, obwohl er eigentlich am Anfang stehen sollte. So schnell wird die Ordnung der Dinge durcheinandergeworfen, wenn es ums poetische Übersetzen geht? Ist das nicht ein bisschen, wie das Englische sagen würde, on the nose? Das Englische sagt on the nose, wo das Deutsche zu offensichtlich und das Spanische vielleicht muy a la vista sagen würden, weil uns zu deutlich gezeigt wird, was wir ohnehin schon sehen. Mir hat immer gefallen, dass in der Übersetzung der idiomatischen Wendung ein impliziertes Wahrnehmungsorgan (das Auge) gegen ein anderes (die Nase) ausgetauscht wird. Obwohl es so gar nicht gemeint ist, da es nicht um die Nase an sich geht, sondern sich das Bild von einem Schlag auf die Nase ableitet – und so wie dieser Schlag sei auch das Überdeutliche, on the nose.
So stellt sich die Sache jedenfalls dar, wenn ich mir ein Auge zuhalte und nur eine Sprache anschaue, das Englische in dem Fall. Wenn ich aber beide Sprachen zusammensehe, wie in einem alten Stereoskop, sehe ich die Beziehungen zwischen den Wortfeldern und Phänomenen ‚Auge und Nase‘. Und dann denke ich mir die Nase als ein hochtaktiles Wahrnehmungsorgan, das sich eben beschwert, wenn Dinge zu eindeutig riechen. Ich mache also einen Fehler, weil ich mehr auf die Beziehungen zwischen Sprachen schaue als auf die Bedeutungen. Ich sehe übersetzerisch, das heißt, mindestens doppelt, und hypersetzerisch, also eher multiperspektivisch. Ich sehe, indem ich die Dinge nicht in ihren nationalen Sprachgeschichten lasse, zugleich mehr und weniger. Ich sehe verwirrt. A nose is a nose is a nose is a nose. Die Nase, die ich meine, ist gar nicht in der idiomatischen Wendung drin. Diese Nase hat keinen Ort, ist nur zwischen den Sprachen, in ihren Beziehungen zueinander angesiedelt. Ist es das vielleicht, was der Untertitel des Festivals andeuten möchte? Die Welt so zu sehen, wie Übersetzer:innen sie sähen, multiperspektivisch, relational, überlappend, überdeutlich und synästhetisch wahrnehmend? Und wenn ja, was folgte daraus? Wozu ist das gut?
II
Mit meinem naiven stereoskopischen Blick lese ich die Latinale-Anthologie „Translator’s Choice“. Da es keine Nasen-Stellen gibt, schreibe ich mir alle Stellen heraus, in denen das Wort „Mund“ vorkommt. Dabei entsteht ein Gedicht, das keinen Ort hat.
von der mundflora (ein cento)
von innen kam ona
trat durch den mund zutage
do outro lado o mundo
—so zerrissen und alles— der mund aufmerksam
die lippen in bewegung
hauch mir ins ohr (sagte sie) bloß nichts dummes sagen
ins ohr und dann in den mund (hauche) (sag es mir dort)
do outro lado o mundo
ist der träumer (sagt) ein erwachender tunnel
mit kaputtem mund spuckt der träumer traumstücke aus
mit kaputtem mund singt er
trällert er (sagt)
COPA DEL MUNDO FIFA 1974
Poner la contraseña para iniciar sesión
Poner la contraseña para iniciar sesión
Dein erster Mund will Ordnung
Dein zweiter Mund hat immer Durst
es entender la realidad de un mundo donde
Dein dritter Mund will münden:
ein Meer viel größer als dein Schlund
las estructuras son tibiamente creadas para fines específicos
– ausgelöscht? –
schellenweise glöckchen schlagend
von innen kam ona
trat durch den mund zutage
esa niña … espiando del mundo (el variopinto)
hauch mir ins ohr (sagte sie)
in meinem mund brauch ich
keine musik
III
Das Wort mundo hat die Bedeutung „Welt, Erde“ in den Sprachen Aragonesisch, Bikolano, Chavacano oder Zamboangueño, Galicisch oder Galego, Interlingua, Ladinisch, Lateinisch, Portugiesisch, Spanisch und Tagalog und sicher einigen mehr. An der Liste lassen sich die Verbindungen zwischen Sprachgeschichte und Kolonialgeschichte ablesen. Die missionierende Kirche dokumentierte während der Kolonialzeit einheimische Sprachen und ihre Grammatiken, sie übersetzte, um sich durchzusetzen. Imperiale Kolonialmächte dagegen bewirkten die Zersetzung, Zersplitterung, Zerstörung von einheimischen Sprachen, verschifften und verschleppten Menschen nach Gutdünken und gruppierten Sprecher verschiedenster Sprachen zusammen, die sich nicht verständigen konnten – so wanderten Wörter gezwungenermaßen zwischen Sprachen, so begann die Ära des imperialen monolingualen Denkens, so begannen auch die Kreolsprachen.
Aber Herrschaft lässt sich beileibe nicht nur in der Anwesenheit des konquistadorischen Wortes „mundo“ in philippinischen Sprachen ablesen. Auch das deutsche „Mund“ hat eine zweite Schicht, die sich in dem Wort „Vormund“ noch erhalten hat. Im Mittelalter bezeichnete Mund die „Herrschafts- und Schutzgewalt über Personen und Sachen“ und war verwandt mit „Hand“ und „Schutz“, wozu lat. mandāre „übergeben, anvertrauen, überlassen“ gehört. Der Mund ist vielleicht alles, was der Fall ist. Aber die Welt ist nicht alles, was der Mund ist, sondern zumeist auch das, was ihm verboten wurde. Und was das Wort „Welt“ angeht, da hat die österreichische Autorin Ilse Aichinger in ihrem Prosaband Schlechte Wörter bereits alles gesagt: „Wult wäre besser als Welt. Weniger brauchbar, weniger geschickt. Arde besser als Erde. Aber nun ist es so. Normandie heißt Normandie und nicht anders. Das Übrige auch. Alles ist eingestellt. Aufeinander, wie man sagt. Und wie man auch sieht. Und wie man auch nicht sieht.“
Ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht auf die Idee kommen, „mundo“ durch „Mund“ zu übersetzen, es sei denn, der mir anvertraute poetische Text signalisiert mir durch irgendeine Regel, dass ich es tun kann oder muss. Aber dass ich die Worte zusammen sehe, kann ich nicht abstellen. Indem ich sie zusammenlese, lege ich mehr oder weniger arbiträre Beziehungen zwischen Worten als Karten aus und finde auf ihnen Wege, denen ich folge. So ist es mir möglich, zu tieferen Sprach- und Emotionsschichten vorzudringen und mir zu vergegenwärtigen, was nicht gesagt wird. Aber was sind schon arbiträre Beziehungen? Oder anders gefragt, was ist arbiträrer, als im Namen einer Religion, einer Ideologie, im Namen von Profitgier und Überlegenheitsfantasien organisierten, strukturierten Genozid und Linguizid zu begehen? Ich habe einfach zwei Wörter angehoben und darunter lauter dunkles Wimmeln gefunden. Kein Wort, das nicht von der Erfahrung sprechen könnte, unterdrückt oder zum Schweigen gebracht worden zu sein. Man muss nur den Kontext verschieben, die Satzgrenze, die Wortgrenze, die Sprachgrenze, den zeitlichen Horizont, die Wahrnehmung, das Auge sein lassen eine Nase, die Nase einen Mund und den Mund ein Herz.
IV
Im Galicischen heißt mundo auch stumm oder gemahlen.
Im Lateinischen heißt mundō auch sauber.
Im Finnischen heißt mundo einfach nur Droge.
Ein Tagalog-Synonym für Erde heißt daigdig.
Daigdig bedeutete früher auch Donner, denn ein alter Tagalog-Glaube besagt, dass man Gewitter und Donner auf der ganzen Welt hören kann. Daigdig bezeichnete folglich die Sphäre Welt als den Ort, der von Donner erreicht wird, und heute ist davon die Bedeutung „Erde“ übriggeblieben.
Übersetzer:innen haben die Wahl. Sie wählen das Wort „Erde“ oder „Welt“, wenn sie mundo übersetzen. Aber sie haben auch die Wahl, den Donner zu hören, der hinter jedem Wort liegt, wie Geister, Gespenster. Dazu haben sie alle Zeit der Welt.
Es ist ein Glück, dass das spanische Wort „temporal“ sowohl „zeitlich“ als auch „Unwetter, Sturm“ heißt.
V
„Language is migrant“, schreibt die chilenische Künstlerin und Dichterin Cecilia Vicuña, deren Texte von Beginn an das betreiben, was ich „etymologischen Gossip“ nenne – Worte wie Koffer öffnen, ihre Routen und Bestandteile emphatisch lesen, mögliche Beziehungen zwischen Worten finden, die nicht unbedingt linguistisch belegte Verwandtschaftsbeziehungen sein müssen, sondern mögliche illegitime, verborgene oder verschwiegene oder verwandelte Verwandtschaften. „Making kin”, mit Donna Haraway gesprochen: „Die Aufgabe besteht darin, sich entlang erfinderischer Verbindungslinien verwandt zu machen und eine Praxis des Lernens zu entwickeln, die es uns ermöglicht, in einer dichten Gegenwart und miteinander gut zu leben und zu sterben.“ (Sich verwandt machen Ebook, S. 10) Indem man sich so verwandt macht, rührt man „wichtige Dinge auf; zum Beispiel die Frage, wem gegenüber man eigentlich verantwortlich ist.“ (ebd. 10/11)
Und weiter Cecilia Vicuña: „Words move from language to language, from culture to culture, from mouth to mouth. Our bodies are migrants, cells and bacteria are migrants too. Even galaxies migrate.
What is then this talk against migrants? It can only be talk against ourselves, against life itself.
20 years ago, I opened up the word ‚migrant‘, seeing it as a dangerous mix of Latin and Germanic roots. I imagined ‚migrant‘ was probably composed of mei (Latin), to change or move, and gra, ‚heart‘ from the Germanic kerd. Thus, ‚migrant‘ became: ‚changed heart‘, a heart in pain, changing the heart of the earth. The word ‚immigrant‘ really says: ‚grant me life‘.“
Cecilia Vicuña öffnet das Wort migrant, seine Wortwurzeln und seine Luftwurzeln. Das Merkwürdige daran ist, dass bei ihren etymologischen Spekulationen das Wort am Ende fast identisch bei sich ankommt – migrant und grant me –, nur einmal um die eigene Weltachse gedreht. Für mich ist dieses Drehen, diese Volte, diese Formel eine poetische Utopie des Übersetzens in nuce – Worte wandern lassen, Leben geben, nicht durch Ersetzen und Äquivalenz, sondern durch In-Beziehung-Setzen und illegitime Ähnlichkeit. Aber kann man so wirklich übersetzen?
VI
Auch eine Nase kann ein ganzes Weltall beinhalten. Die Nase des Sternmulls ist mit zweiundzwanzig beweglichen Tentakeln bestückt, die winzigen Fingern ähneln, elf Stück an jedem Nasenloch. Die Bewegungen dieser Tastorgane sind so schnell, dass das menschliche Auge sie nicht sehen kann. Man vermutet auch, dass diese Finger- oder Tastzipfel als Elektrorezeptoren fungieren. Mit ihnen können sie elektrische Impulse wahrnehmen, die bei der Muskelbewegung ihrer Beutetiere entstehen.
A nose is a nose is a nose. Und a rose is a rose is a rose.
„Yes, I'm no fool; but I think that in that line the rose is red for the first time in English poetry for a hundred years.” So wie Gertrude Stein in ihrem berühmten Rosen-Satz, der nur das Nomen rose umkreiste, ein Rot verwirklicht sah, sehe ich im übersetzerischen Missverstehen oder Ähnlichsehen ein sternartiges Wahrnehmungsorgan, das hochsensibel und synästhetisch auf Sprache reagiert.
VII
In ihrem Gedichtband O Resplandor beschreibt die kanadische Lyrikerin und Übersetzerin Erín Moure (aus dem Französischen, Spanischen und Galicischen) eine kuriose Übersetzungssituation. Gebannt von den Gedichten des rumänischen Lyrikers Nichita Stănescu, die sie nicht versteht, beginnt eine Figur namens Elisa Sampedrín, diesen zu übersetzen:
„When I first started translating Stănescu, I didn’t know Romanian. ‚Alba‘ looked to me like ‚albumin,‘ so I translated it as albumin. Later I found out it was the feminine of ‚white‘. Albumin then became even more accurate. Stănescu was urgently saying albumin.
My mouth filled utterly with this word.
(…)
- Do you know this is the ruin of translation if you go on like this?“
Auch Elisa Sampedrín kommt durch illegitimes Übersetzen, also Übersetzen nach Ähnlichkeit, bei einem richtigen, das heißt eng mit dem Original verwandten Ergebnis an. Doch sogleich sagt sie sich, oder legt eine Stimme ihr nahe, dies wäre das Ende des Übersetzens, solche Operationen durchzuführen. Das Wunderbare an dem Gedichtband ist, dass er zeigt, dass es die eine richtige, legitime Übersetzung eines poetischen Texts nicht geben kann. Stattdessen gibt es verschiedene Versionen, Rückübersetzungen, und Übersetzungen ohne Originale, dazu essayistische Passagen und ein Vexierspiel zwischen Kanada und Bukarest, zwischen den Figuren Erín Moure, Elisa Sampedrín und Oana Avasilichioaei, die Stănescu in Wirklichkeit – in welcher Wirklichkeit? – ins Englische übersetzt. Am Anfang der übersetzerischen Bewegungen aber steht die Begegnung mit dem rumänischen Original, das wie ein Schock erlebt wird. Die Materialität der Buchstaben, die Schönheit der Sprache auf der Seite, die vermuteten Klänge bei der Aussprache lösen ein körperliches Begehren aus, dieser Sprache nahe zu kommen und den „screen“, den Schleier oder die Trennwand der eigenen Sprache zu überwinden:
„Something had to be altered in my body, to compensate for the screen of my language that stood between me and the poem. I unsocked myself. I unshoed myself. / I was a stalk of grain and light.”
Der Buchtitel „O resplandor“ ist Portugiesisch/Galicisch und bedeutet Glanz, Lichtschein, Lichtschimmer.
Elisa Sampedrín ist von dem Original geblendet. Sie sieht zu viel Licht.
Wer übersetzt, sieht zu viel Licht, aber nicht mit den Augen.
An einer Stelle berichtet Elisa Sampedrín von Forschungen, die sich mit den Lichtrezeptoren des menschlichen Körpers beschäftigen. Nicht nur die Retina sei für die Wahrnehmung von Licht und damit für unsere innere Uhr (circadian time) verantwortlich. Wissenschaftliche Studien mit Zellproben aus der Mundhöhle wiesen nach, dass auch elektromagnetische Impulse an der Zungenspitze das visuelle System stimulieren können. Sampedrín übersetzt: „The mouth itself responds to light. We feel time passing, this way, in the mouth.“
Wangenpassagen, Lichtwechsel. Wenn wir unsere Wahrnehmungsmechanismen überdenken und verschieben, verschieben und überdenken sich dann auch unsere Übersetzungsmechanismen? Wenn wir mit dem Mund sehen können, wie übersetzen wir dann el mundo?
Erik Weihenmeyer ist der einzige blinde Mensch, der je den Mount Everest bestiegen hat. In einem 2017 im New Yorker erschienenen Artikel wird ein neues Gerät beschrieben, das es ihm erlaubt, mit seiner Zunge zu sehen. Es heißt „BrainPort“ und besteht aus einem um seine Augenbrauen gelegten Band mit einer kleinen Videokamera und einem mit dieser Kamera verkabelten weißen Plastiklolli, so groß wie eine Briefmarke, der ihm im Mund steckt. Die Bilder der Kamera werden in ein graues Pixelschema umgerechnet und mittels 400 Elektroden als Signale auf seine Zunge übertragen. Dunkle Pixel resultieren in einem starken Schock, helle Pixel in einem schwachen. Die visuellen Reize beschreibt Weihenmayer als „Bilder wie gemalt aus winzigen Blasen“.
VIII
Erín Moures Alter Ego Elisa Sampedrín muss alles übersetzen, um wieder lesen zu können. Aber geht es uns nicht eigentlich immer so? Dass wir nicht verstehen, übersetzen müssen, im Gedicht? Poetische Übersetzung ist im Grunde ein Erkenntnisbegehren, das nicht von einer vorliegenden Übersetzung beschlossen, sondern vielmehr aufgeschlossen wird: „and it entered me. I could not turn away from it“, heißt es in O Resplandor. Die Begegnung mit der fremden, körperlich empfundenen Sprache bringt auch die eigene Selbst-Verständlichkeit und sprachliche Gewissheiten ins Wanken und bewirkt, dass man keine Sprache mehr versteht. Um zu verstehen, muss ich übersetzen, aber wie übersetze ich, wenn ich nichts verstehe, nicht einmal meine eigene Sprache? Ich muss an das Kartengleichnis aus Inger Christensens Aufsatz Der Geheimniszustand denken, das an Jorge Luis Borges’ Kurzgeschichte Del rigor en la ciencia anspielt: „Man hat sich also wirklich auf eine besondere Weise verirrt. Man muß nämlich einen Weg durch die Landschaft finden, wenn man die Karte zeichnen können will, aber zugleich muß man die Karte zeichnen, wenn man einen Weg durch die Landschaft finden können will.“ Inger Christensen bezog dieses erkenntnistheoretische Dilemma auf das Verhältnis zwischen Poesie und Welt. Selbst wenn es „in der Geschichte der Poesie Karten aller Arten von Landschaften [gibt], wo alle möglichen Brücken eingezeichnet sind“, bedeutet der Moment des Schreibens, dass sich die Brücken wegbewegen, die Karte unzuverlässig wird. Jedes Mal muss man von neuem beginnen. Man muss „genau das zufällige Wort wählen, das notwendig gemacht werden kann. Ein Wort notwendig machen heißt Wort und Phänomen verketten oder verschmelzen. Nicht so, daß die Zufälligkeit aufgehoben wird, denn auch nach der Wahl bleibt das Wort genauso zufällig wie vorher. Aber in all seiner Zufälligkeit ist es mit dem Phänomen zusammen in den Geheimniszustand versetzt, wo die innere und die äußere Welt sich zusammen befinden, als wären sie nicht voneinander getrennt gewesen.“
IX
In den a b a p o r u-Fragmenten von Caro García Vautier, die im guaranitischen Grenz- und Flussland im Dreiländerraum Brasilien-Paraguay-Argentinien angesiedelt sind und dynamische Sprachsedimente kombinieren, finde ich eine Wendung, die sich wie eine Metapher für poetisch-utopisches Übersetzerdenken liest. Natürlich, ich nehme sie hier aus dem Kontext. Aber was heißt schon Kontext, wer führt das Wort im Mund oder in der Hand, wer bestimmt die Zeit, wer zieht welche Grenze zum Schutz oder zum Beherrschen?
Die Übersetzung stammt von Léonce W. Lupette:
en tu lugar ahora un temporal de fantasmas en estampida lucidez, batallas.
an deiner statt jetzt ein gespenstersturm stampedener klarheit, gefechte.
„An deiner statt“ kann heißen, dass die Sprecherinstanz des Gedichts (die ohnehin nur implizit da ist), welche die Licht- und Bewegungsverhältnisse im Flussland wahrnimmt und notiert, von der sprachlich fixierten Wahrnehmung ersetzt wird. Der „gespenstersturm stampedener klarheit“ bezeichnet dann vielleicht ein beobachtetes Wetterphänomen. Oder es bezeichnet die Worte, die in ihrer klanglichen Dichte und Materialität selbst einen wahrnehmbaren Sturm auf der Seite entfesseln. „An deiner statt“ deutet dann auch hin auf den Ort (lugar) des Gedichts, und auf das Gedicht selbst, das in seinem Vollzug erst stattfindet, sich findet.
„An deiner statt“ kann aber auch heißen: an Stelle des Originals steht hier die Übersetzung. Eine Übersetzung, die, wenn sie glückt, auch die Kombination von Notwendigkeit und Zufall bei der Wortwahl mitübersetzt, von der Inger Christensen spricht. Die Grenze der Notwendigkeit, wird man sagen, sei natürlich vom Original vorgegeben, man müsse notwendigerweise die Worte übersetzen, die dastehen. Das sei anders, wenn man ein Gedicht schriebe: dann sei nichts vorgegeben. (Inger Christensen würde hier, auf der einen Schulter mit Novalis und den Frühromantikern, auf der anderen Schulter die Mathematik und Noam Chomsky, heftig widersprechen. Aber egal.) Gemeinhin ist mit „die Worte, die dastehen“ gemeint, man müsse den Sinn oder die Bedeutung der Worte übersetzen. Aber in Gedichten und poetischen Texten wird die Notwendigkeit ebenso von der Wortform, von Klang, von bestimmten Buchstabenclustern oder von zwingend-wilden Assoziationen bestimmt, von der ganzen poetischen Rede, die, so Henri Meschonnic in Ethik und Politik des Übersetzens, „ein ethischer Akt ist, der das Subjekt verändert, denjenigen, der schreibt, und denjenigen, der liest.“ Nur den Sinn der Worte zu übersetzen, das wäre, als würde man behaupten, ein Eisberg bestünde nur aus seiner Spitze. Was dann geschieht, weiß man: die Übersetzung kollidiert mit dem ganzen sinnlich-körperlichen Rest und erleidet Schiffbruch, das Poetische säuft ab, und damit auch das Ethische.
Wenn die Übersetzung sagt „an deiner statt“, dann spricht hier auch das poetische Sprachhandeln, das ein Subjekt – viele mögliche Subjekte – zutage treten lässt. Dieses Handeln lässt sich auf das Spiel zwischen Notwendigkeit und Zufall ein und sieht multiperspektivisch, sieht die Beziehungen zwischen einer Vielzahl von Sprachen. Es lässt sich darauf ein, ebenso wie das „Original“ stattzufinden. In der Übersetzung von Léonce W. Lupette merke ich sofort, dass etwas stattfindet, noch bevor (lange bevor) ich mich frage, ob ich verstehe, oder was ich verstehe.
an deiner statt jetzt ein gespenstersturm stampedener klarheit, gefechte.
Die vierfache Wiederholung der Buchstaben „st“, die so zufällig erscheinende Verteilung der Vokale a und e, gesprenkelt mit dreimal dem Diphtong „ei“. Und in der Mitte, wie im Auge des Vokalwetters oder Vokalunwetters, allein und verstörend das „u“ von „Sturm“. All das nehme ich wahr, ich sehe es mit den Augen, mit dem Mund, mit dem Körper, und es erscheint mir schön und absolut zwingend. Am meisten interessiert mich aber das Adjektiv „stampedener“, das aus zu großer stereoskopischer Nähe zu dem Wort „estampida“ entstanden zu sein scheint. Tatsächlich gibt es im Duden das Substantiv „Stampede“ – ein seltenes Lehnwort für eine in Panik geratene Rinderherde. Als Adjektiv aber ist es ein Neologismus. Witzigerweise stammt das spanische Wort „estampida“ wiederum aus dem Deutschen „stampfen“ bzw. früher „stempen“ ab. Hätte man also an dieser Stelle für das geläufige spanische Wort auch ein geläufiges deutsches Wort auswählen können? Ich meine „stampfende klarheit“? Aber nein, das klingt ja zum Weglaufen! Es wäre zu nah gewesen, zu sehr mit sich identisch, zu notwendig – aber zu wenig zufällig. Der schwebende Klang des vorhergehenden Wortes „gespenstersturm“ wäre totgetrampelt oder totgestempelt von „stampfen“. Im Wort „stampedener“ setzt sich das Schweben der Gespenster durch Wiederholung der drei „e“s fort. Und auch inhaltlich „macht“ das Wort, wovon es spricht: der etymologisch verfremdete Neologismus ist selbst eine Art Gespensterebene, da er vergangene Sprachschichten präsent macht. Um poetisch wirksam zu werden, braucht die Übersetzung etwas, das sie selbst überrascht: in dem sie buchstäblich Gespenster sieht.
Und die Leserin sieht noch ein anderes Gespenst: im Mittelniederdeutschen gab es eine Sonderbedeutung von „stempen“ im Sinne von: etwas anstellen, etwas hervorbringen: Poiesis. Vielleicht heißt stampedene Klarheit dann gar nicht durcheinanderwirbelnde oder trampelnde Klarheit, sondern gemachte Klarheit, schöpferische Klarheit, die utopisch-poetische Klarheit eines multisensorischen und multilingualen Übersetzerdenkens?
X
Hier muss ich an den Dichter und Übersetzer Felix Philip Ingold denken, der in einem Essay zum Übersetzen schrieb: „Als ich dann auch selbst zu schreiben begann, wurde mir mehr und mehr bewußt, daß ja eigentlich jede sprachliche Geste eine übersetzerische Geste ist; […] daß ja auch schon beim Reden, hier und jetzt, ‚übersetzt‘ wird, was man an Ungesagtem oder Unsäglichem zu sagen, in Worte zu fassen hat. Keine Sprache, am wenigsten die eigene, ist ein integrales Ganzes. Jede Sprache umfaßt eine Vielzahl von ‚Sprachen‘. Und da keine Sprache als ‚meine‘ Sprache gegeben ist, kann ich die eigene Sprache einzig durch Übersetzung gewinnen. Also muß ich die Sprache, damit sie ‚meine‘ Sprache werden kann, immer wieder (stets von neuem) in sich selbst übersetzen. So daß ich auch als Autor, wenn ich mich und meine Arbeit ernstnehme, nur Übersetzer sein kann. An ihren Übersetzungen – und nicht an ihren ‚Originalen‘ – sind die Dichter zu erkennen.“
XI
Die Übersetzerin Eva Hesse, die jahrelang Ezra Pound ins Deutsche übertrug, hatte einmal eine Nachfrage zu einer Textstelle und erlaubte sich dem Dichter gegenüber die Anmerkung, er habe dann das Gegenteil geschrieben von dem, was er meinte. Pound antwortete prompt: „Damn it! Don’t translate what I wrote. Translate what I meant to write!“ Diese Antwort bedeutete für die Übersetzerin „eine total veränderte Versuchsanordnung“ in der Arbeit am Text, „den beide je nach ihren Möglichkeiten aus der Schwebe in die eigene sprachliche Aktualität zu holen suchen“.
Was mir daran gefällt, ist die Vorstellung eines in der Schwebe gehaltenen Textes, der von einem schreibenden Autor-Übersetzer-Paar in eine sprachliche Gegenwart geholt wird, also in seiner Übersetzung jeweils neu vergegenwärtigt wird, wie es auch Walter Benjamin beschrieb. In der Anleitung „Translate what I meant to write“ aber lebt eine Vorstellung von Intentionalität, die ich nach allem, was wir über Notwendigkeit und Zufall in der poetischen Rede gesagt haben, abwegig finde.
Eva Hesse schreibt, ihr wäre nach diesem und anderen Gesprächen mit Pound im Laufe der langjährigen Zusammenarbeit die Frage „Wie hätte der Autor das auf Deutsch gesagt“ wichtiger geworden als „die lexikalische Stimmigkeit der Worte“.
Ich meine zu wissen was sie meint, aber ich wünschte, sie hätte das Gegenteil geschrieben. Nicht: Wie hätte es der Autor, sondern wie hätte es die Sprache auf Deutsch gesagt? Wie sagt es die eine, von vielen Sprachen durchsetzte Sprache, der anderen, von vielen Sprachen durchsetzten Sprache, wie sagt es der Weg, der dabei gegangen wird, durch alle lokalen, instabilen Sprachbeziehungen in meinem Körper? Gespenstersturm, anyone? Sollte man vielleicht lieber sagen: Don’t translate what she wrote. Translate what the text continues to write? Übersetzer:innen haben die Wahl. Dazu haben sie alle Gespensterstürme der Welt.
XII
Auch Odile Kennel hat in ihrer Übersetzung der Gedichte von beatriz rgb ein Wort gesehen, das nicht geschrieben wurde. Sie übersetze nicht, was dastand, sondern das, was sie sah und was sie hörte. Im Original lautet die Stelle aus dem Gedicht MARLENE DIETRICH SABE O QUE ESCORRE DA COXA QUANDO ENTRA NO CAMARIM E SE PERGUNTA QUEM A ESPERA – auf Deutsch MARLENE DIETRICH WEISS WAS DIE SCHENKEL ENTLANG RINNT WENN SIE DEN BACKSTAGE BETRITT UND SICH FRAGT WER AUF SIE WARTET:
em perpétua sentença
morrem-nas-cheias
renascem-nas-estiagens
confuses em densos turnos
de um plutoniano fluxo
que feio ficar no meio, Quéfren,
chega junto e não se faz de muro
Die weiblichen Stimmen des Gedichts, von Marlene Dietrich bis zu den Yabá der Yoruba, fordern eine Art altägyptischen König (den Chef Chefren) heraus, aus seiner mittigen Machtposition zu treten. Die Aufforderung lautet, wörtlich übersetzt, man und in diesem Fall auch „Mann“ solle zusammenkommen und keine Mauer errichten. Aus der Mauer ist in der Übersetzung das Wort „Zäune“ geworden und die Mitte des Chefs übersetzt sich in eine Binnenland-EU:
lebenslänglich
sterben-sie-in-der-flut
werden-wiedergeboren-bei-ebbe
konfus vom schnellen wechsel
eines plutonischen flusses
grenzt an zäune ceuta
lass dich nicht aufstacheln lass durch
Die spanische Exklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste wird seit 1993 von einem Grenzzaun umgeben. 2005 wurde der Zaun von drei Meter auf sechs Meter erhöht. Dass Zäune und Ceuta ähnlich klingen, mag ein Grund für die Verschiebung gewesen sein. Die vorhergehenden Zeilen lassen an das Schicksal von Flüchtenden denken, die ihr Leben riskieren und verlieren bei dem Versuch, eine menschenwürdige Existenz zu finden auf der anderen Seite des Wassers. So ist Ceuta Synonym geworden mit einem Zaundenken, einem Mauerdenken, das Migrant:innen draußen halten will. Das utopische Übersetzer:innendenken darf auch Zäune verschieben, darf Kontexte verschieben. So kommt Ceuta hier ins Gedicht, wo es nicht in Worten steht, aber in einer Beziehung zu allen wegen Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, sexueller Orientierung, gesellschaftlichem Status ausgegrenzten Menxchen. Ich sehe darin keine domestizierende, übergreifende Lokalisierungs- oder Transpositionsstrategie. Sondern das Resultat eines multisensorischen, körperlichen, emphatischen Übersetzens, das mehr sieht, das halluziniert, das „Wult“ sagt und nicht „Welt“ und damit Widerstand leistet und Hoffnung gibt.
XIII
Sagte man nicht früher einmal, ein Gedicht in Übersetzung sei wie eine behandschuhte Hand zu küssen?
Erín Moure: I unhandshoed myself. I ungloved myself. I slipped my naked hand into the glove compartment which was called love compartment. It was also accidentally loba's globe compartment. No, it was the occipital lobe compartment. I was told I could take out my hand. There were seven tiny eyes on each of my fingers. They were blinking with utmost gentleness. I wanted to take care of them for the rest of my life..
Will man poetisches Übersetzen utopisch denken, muss der Handschuh umgestülpt werden. Wie wäre es zu sagen, ein Gedicht in Übersetzung zu lesen (ein Gedicht zu übersetzen) sei wie Licht mit dem Mund zu sehen? Licht als Zeit zu sehen? Gespensterstürme auf der Zungenspitze zu sehen?